
„Das Gesundheitssystem wird unter Druck geraten“
Teil 3: Interview – Arzt Bernhard Winter über den Vorwurf einer Zweiklassenmedizin
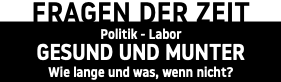
choices: Herr Winter, wie hat sich das System aus gesetzlichen und privaten Krankenkassen historisch entwickelt?
Bernhard Winter: Da müssen wir ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Damals gab es noch keine Krankenversicherung, aber durch die Industrialisierung hatten sich die Großfamilien aufgelöst, die ihre Kranken zuvor mitversorgt hatten. Als Reaktion darauf hat einerseits die Arbeiterbewegung selbst Krankenkassen geschaffen, um sich gegenseitig bei Krankheiten solidarisch zu unterstützen, andererseits geschah dies aber auch durch die Betriebe, denn dort sah man eben auch, dass die Menschen bei Krankheit nicht mehr versorgt wurden und dies den Betriebsablauf stören konnte – aus diesen Ansätzen entwickelten sich die Betriebskrankenkassen. Die Initialzündung kam also von beiden Seiten. Bismarck wird ja gerne als Erfinder der Krankenkassen gefeiert, im Grunde hat er diese aber nur gesetzlich institutionalisiert und die Arbeiter zur Krankenversicherung verpflichtet. Daher kommt der Begriff „Gesetzliche Krankenversicherung“ (GKV). Anfangs war es so, dass alle anderen Berufsgruppen privat bezahlt haben, später wurden immer mehr Berufs- und Bevölkerungsgruppen in die gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen – das war ein Prozess, der gut 100 Jahre in Anspruch genommen hat. Als letzte Gruppe kamen in den 1980er Jahren die Studenten dazu. Gleichzeitig wurde es aber reicheren Menschen, denen man unterstellt hat, dass sie ausreichend Geld hatten um vorzusorgen, freigestellt, ob sie sich versichern wollten, wenn sie über der sogenannten Pflichtversicherungsgrenze lagen. Für die wurden dann die Angebote der Privatversicherungen geschaffen, in die dann auch die Beamten aufgenommen wurden. So hat es sich entwickelt, dass heute 90 Prozent der Bevölkerung in der gesetzlichen Krankenversicherung sind und 10 Prozent in den privaten.
„Ein Relikt des Kaiserreichs“
Für manche Berufsgruppen, wie etwa Beamte, besteht bis heute keine gesetzliche Versicherungspflicht. Wie kommt es zu diesen Ausnahmen?
Naja, die Konturen des Systems wurden zu Zeiten des Kaiserreichs geschaffen und die Obrigkeiten waren bestrebt, die Schicht der Beamten möglichst stark an sich zu binden. Das ist quasi ein Relikt aus dieser Zeit. Auch in der Weimarer Republik wurde dieses Privileg aufrechterhalten, weil man sich deren Loyalität erkaufen wollte. Das kommt ganz sicherlich daher und dieser Gedanke hatte sich dann in der Bundesrepublik tradiert. Gerade die Sonderstellung der Beamten wird inzwischen, besonders aufs Länderebene, ja durchaus kritisch gesehen und es wird versucht, davon wegzukommen, dass Beamte automatisch in die Private Versicherung gehen – Hamburg etwa bietet seinen Beamten an, dass sie auch in die GKV gehen können. Aber dieser Prozess ist etwas zum Stillstand gekommen – vor ein paar Jahren war das ein großes Thema, aber offensichtlich sind die Länder da ein wenig unter Druck geraten.
In welcher Beziehung stehen gesetzliche und private Kassen zueinander?
Es sind in sich abgeschlossene, parallele Systeme. Sie können im Grunde nur wechseln, wenn sie viel Geld verdienen, der normal gesetzlich Krankenversicherte hat gar nicht die Chance ins System der Privatversicherungen zu gehen. Insofern stehen sie allenfalls um höher verdienende Versicherte in Konkurrenz, dem Großteil der Bevölkerung steht die Privatversicherung gar nicht zur Verfügung. Die beiden Systeme sind auch organisatorisch ganz unterschiedlich aufgestellt: Bei den gesetzlichen Krankenkassen verhandeln die Kassenverbünde mit den kassenärztlichen Vereinigungen, davon bekommt der Normalversicherte in der Regel nichts mit. Der Versicherte bezahlt seinen Beitrag und erhält Leistungen aus der Krankenkasse, die die Krankenkasse mit den kassenärztlichen Vereinigungen abrechnet – unabhängig davon, ob er den Pflichtbeitrag oder den Maximalbeitrag zahlt. Bei den Privatversicherungen ist es so, dass die Einzelperson einen Vertrag mit dem Arzt schließt. Der Patient bekommt vom Arzt die Rechnung, die dann von der Krankenkasse bezahlt wird.
„Privatversicherungen versichern reiche, weniger kranke Personen“
Der Vorwurf lautet, das System führe zu einer Zweiklassenmedizin. Ist da was dran?
Dadurch, dass die Privatversicherungen nur Höherverdienenden und Beamten offenstehen, können die dort Versicherten den Ärzten mehr Geld zahlen als die gesetzlichen Krankenkassen. Warum ist das so? Zum einen sind bessergestellte Personen weniger krank, zum andere können sich Privatkassen die Risiken aber auch aussuchen – sie können zu Person X sagen: „Nein, du bist mir zu krank, du hast zu viele Vorerkrankungen, dich nehmen wir nicht, oder nur mit einem sehr hohen Aufschlag.“ Gesetzliche Krankenkassen dürfen das nicht. Wenn die Kriterien erfüllt sind – zum Beispiel, dass man eine Arbeitsstelle hat – muss jede gesetzliche Krankenkasse diese Person aufnehmen. Das heißt, Privatversicherungen versichern reiche, weniger kranke Personen, können aber im tatsächlichen Krankenfall mehr Geld bezahlen. Das heißt, für den einzelnen Arzt, der betriebswirtschaftlich denkt, rentiert es sich sehr wohl, Privatpatienten zu bevorzugen und dafür zu sorgen, dass er möglichst viele Privatpatienten bekommt. Zumal er bei Privatpatienten das Leistungsspektrum ausdehnen kann, auch auf Leistungen, die nicht als medizinisch wirksam anerkannt sind. Wir haben ein System, den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), der festlegt, welche Leistungen die Krankenkassen bezahlen müssen – für diese Leistungen wird gefordert, dass nachgewiesen wird, was medizinisch wirksam ist. Das ist bei Privatversicherungen nicht der Fall, da kann der Arzt auch mal sagen, „ach, lassen sie uns mal diese oder jene Maßnahme machen, die ist zwar noch nicht allgemein anerkannt, aber vielleicht hilft es ja in ihrem individuellen Fall“. So kann das Leistungsspektrum ausgedehnt werden, das geht bei den GKV in keinem Fall. Darum bevorzugen Ärztinnen und Ärzte Privatpatienten.
„Vielleicht will man sich den zweiten Porsche leisten“
Was ergibt sich daraus?
Das geht weiter als man denkt, es ist nicht nur die individuelle Bevorzugung durch eine bessere Terminvergabe oder dass sich die Ärztin oder der Arzt mehr Zeit nimmt. Es hat durchaus Auswirkung auf die Gesamtversorgung der Bevölkerung: In Städten, in denen relativ viele Privatversicherte leben, finden sie in den Stadtmitten eine relativ hohe Arztdichte. Wenn man sich etwa Wiesbaden in Hessen ansieht, das ist eine typische Beamtenstadt, dort finden sie eine sehr hohe Arztdichte. In Offenbach, wo ich arbeite, gibt es relativ wenig Privatversicherte, entsprechend hat es auch eine relativ geringe Arztdichte und in manchen Stadtteilen auch schon einen signifikanten Ärztemangel. Auf der Ebene spielt es also auch eine Rolle, ebenso auf derjenigen der Krankenhäuser – nicht nur in den ambulanten Bereich, da ist es aber am augenfälligsten.
Geht es den Ärztinnen und Ärzten eher um Gewinnmaximierung oder stehen sie unter wirtschaftlichen Zwängen?
Wenn sie die überwiegende Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen befragen, werden sie zur Antwort bekommen: Ja, wir brauchen die Privatpatienten, sonst könnten wir nicht überleben. Meiner Meinung nach ist das Unsinn. Es gibt auch Bereiche, in denen es keine Privatpatienten gibt und die Kollegen, die dort tätig sind, können trotzdem überleben. Ich habe 30 Jahre lang in einer Praxis mit einem sehr geringen Anteil an Privatpatienten gearbeitet und wir hatten ein gutes Gehalt, mussten niemals am Hungertuch nagen. Es geht bei dem Kampf um die Privatpatienten ganz klar um einen Überschuss. Vielleicht will man sich den zweiten Porsche leisten, aber mit Existenzsicherung hat das überhaupt nichts zu tun. Es gibt Zahlen darüber, wieviel durchschnittlich im GKV-Bereich verdient wird – es gibt Fachbereiche, in denen es problematisch ist, das stimmt, aber in der Regel sind das keine niedrigen Gehälter.
„Es steht zu befürchten, dass versucht wird, medizinische Leistungen weiter zu privatisieren“
Konzepte dagegen werden diskutiert, etwa die Bürgerversicherung. Wozu raten Sie?
Wir im Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte halten das Konzept der Bürgerversicherung für absolut notwendig. Bei der Bürgerversicherung wäre es so, dass es eine einheitliche Versicherungsstruktur gäbe, die also quasi als gesetzliche Krankenversicherung für alle zuständig wäre. Eine private Krankenvollversicherung dürfe es dabei nicht mehr geben. Die Versichertenpflichtgrenze, also die Grenze, ab der man sich privat versichern lassen kann, würde aufgehoben, also wären quasi alle gefordert, in eine gesetzliche Krankenkasse zu gehen – man könnte diese Grenze auch auf einen Betrag von etwa 100.000 Euro heben, dann hätten sich die privaten Versicherer auch erledigt. Was noch hinzukommen müsste, wäre die Bemessungsgrenze – das wäre die Grenze, bis zu der Beiträge erhoben werden. Wenn sie heute sehr viel verdienen, dann bezahlen sie für den größten Teil ihres Verdiensts keine Krankenversicherung. Das heißt, auch im gesetzlich krankenversicherten System werden Menschen mit hohem Einkommen begünstigt. Das widerspricht unseres Erachtens dem Solidargedanken. Daher fordern wir, die Ermessungsgrenzen entweder deutlich anzuheben oder ganz aufzuheben. Darüber hinaus, um etwa die Ungleichheiten zwischen verschiedenen Stadtteilen auszugleichen, würden wir eine bessere Planung im ambulanten Bereich fordern – das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, aber das wäre ergänzend notwendig. Auf jeden Fall gilt: Wenn jeder entsprechend seinen finanziellen Möglichkeiten in den gemeinsamen Topf einzahlen würde, würde dies den Solidargedanken ungemein stärken und dem Gesundheitssystem ganz neue Möglichkeiten zur Verfügung stellen.
Wie bewerten sie danach die Politik des vorigen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, einem Befürworter der Bürgerversicherung?
Die Bürgerversicherung war nie ein Thema der Ampel-Koalition, da hat sich die FDP von Anfang an dagegen gestellt – es war also schon im Koalitionsvertrag nicht enthalten. Es war ganz klar, dass es mit der FDP nicht zu machen sein würde, auch wenn SPD und Grüne es gerne gehabt hätten. Demzufolge hat Karl Lauterbach auch keinerlei Vorstöße in die Richtung gemacht, wohlwissend, dass er damit nicht durchkommen würde. Er hat sich vorwiegend auf die Krankenhausreform konzentriert, das war ja sein Kernthema.
„Gesellschaftlichen Druck aufbauen, etwa durch die Gewerkschaften“
Was ist von der neuen Regierung zu erwarten?
Jedenfalls keine Bürgerversicherung. Die gestern vereidigte Bundesregierung hat sie nicht auf dem Plan, denn die CDU will das nicht – es wird in dieser Legislaturperiode also sicherlich keine große Rolle spielen. Es steht eher zu befürchten, dass versucht wird, medizinische Leistungen weiter zu privatisieren oder der arbeitenden Bevölkerung die Kosten aufzudrücken, wie man es beispielsweise beim Zahnersatz schon tut. Beim Zahnersatz ist es so, dass nur noch der Versicherte einen Anteil tragen muss, der Arbeitgeber aber nicht mehr. Das ist sicherlich ein Modell, dass Herrn Merz und anderen gut entgegenkommt. Ich fürchte eher, wenn etwas passiert – und das Gesundheitssystem wird unter Druck geraten, angesichts der enormen Verschuldung, die nun beschlossen wurde – dass es in genau die entgegengesetzte Richtung gehen wird.
Wie wird sich der Druck konkret auswirken?
Bei dieser halben Billion Euro Neuverschuldung, die jetzt kommen soll – da wird man uns schon bald erklären, es sei kein Geld mehr für das Gesundheitssystem da. Man wird versuchen zu kürzen, Leistungen einfach für überflüssig erklären – natürlich gibt es auch überflüssige Leistungen, aber wahrscheinlich wird man es da nicht so genau nehmen. Dann muss man die Menschen mehr zur Kasse bitten, dann wird man das Zuzahlungssystem verschärfen, oder ähnliche Maßnahmen anleiern. Das sind leider keine guten Aussichten, die kann ich im Moment nicht wirklich bieten. Es wird entscheidend sein, inwieweit man in dieser Frage gesellschaftlichen Druck aufbauen kann, etwa durch die Gewerkschaften. Das wird man sehen müssen.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 Hört das Signal
Hört das Signal
Intro – Gesund und munter
 von ch-thema-s1-online-678.jpg) So ein Pech
So ein Pech
Teil 1: Leitartikel – Opfer von Behandlungsfehlern werden alleine gelassen
 von ch-thema-s2-678.jpg) „Der Arzt muss dieses Vertrauen würdigen“
„Der Arzt muss dieses Vertrauen würdigen“
Teil 1: Interview – Kommunikationswissenschaftlerin Annegret Hannawa über die Beziehung zwischen Arzt und Patient
 von ch-thema-s3-678.jpg) Gesundheit ist Patientensache
Gesundheit ist Patientensache
Teil 1: Lokale Initiativen – Die Patientenbeteiligung NRW in Köln
 von tr-thema-s1-online-678.jpg) Heimat statt Pflegeheim
Heimat statt Pflegeheim
Teil 2: Leitartikel – Seniorengerechtes Bauen und Wohnen bleibt ein Problem
 von tr-thema-s2-678.jpg) „Wo Regelmäßigkeit anfängt, sollte Nachbarschaftshilfe aufhören“
„Wo Regelmäßigkeit anfängt, sollte Nachbarschaftshilfe aufhören“
Teil 2: Interview – Architektin Ulrike Scherzer über Wohnen im Alter
 von tr-thema-s3-678.jpg) Gemeinsam statt einsam
Gemeinsam statt einsam
Teil 2: Lokale Initiativen – Wohnen für Senior:innen bei der Baugenossenschaft Bochum
 von en-thema-s1-online-678.jpg) Privatvergnügen
Privatvergnügen
Teil 3: Leitartikel – Die Zweiklassenmedizin diskriminiert die Mehrheit der Gesellschaft
 von en-thema-s3-678.jpg) Verbunden für die Gesundheit
Verbunden für die Gesundheit
Teil 3: Lokale Initiativen – Wuppertals Selbsthilfe-Kontaktstelle unterstützt Bürgerengagement
 von chtren-thema-europa-678.jpg) Senioren und Studenten müssen warten
Senioren und Studenten müssen warten
Das Wohnprojekt Humanitas Deventer verbindet Generationen – Europa-Vorbild: Niederlande
 von chtren-thema-glosse-678.jpg) Wenn der Shareholder das Skalpell schwingt
Wenn der Shareholder das Skalpell schwingt
… und der Patient zur Cashcow wird – Glosse
„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“
Teil 1: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung
„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“
Teil 2: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen
„Weit von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit entfernt“
Teil 3: Interview – Die Rechtswissenschaftlerin Lisa Kadel über die Kriminalisierung von Klimaaktivist:innen
„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“
Teil 1: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns
„Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor“
Teil 2: Interview – Sprachwissenschaftler Thomas Niehr über Sprache in Politik und Populismus
„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“
Teil 3: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen
„Je größer das Vermögen, desto geringer der Steuersatz“
Teil 1: Interview – Finanzwende-Referent Lukas Ott über Erbschaftssteuer und Vermögensungleichheit
„Eine neue Ungleichheitsachse“
Teil 2: Interview – Soziologe Martin Heidenreich über Ungleichheit in Deutschland
„Die gesetzliche Rente wird von interessierter Seite schlechtgeredet“
Teil 3: Interview – VdK-Präsidentin Verena Bentele über eine Stärkung des Rentensystems
„Besser fragen: Welche Defensivwaffen brauchen wir?“
Teil 1: Interview – Philosoph Olaf L. Müller über defensive Aufrüstung und gewaltfreien Widerstand
„Als könne man sich nur mit Waffen erfolgreich verteidigen“
Teil 2: Interview – Der Ko-Vorsitzende des Bundes für Soziale Verteidigung über waffenlosen Widerstand
„Das ist viel kollektives Erbe, das unfriedlich ist“
Teil 3: Interview – Johanniter-Integrationsberaterin Jana Goldberg über Erziehung zum Frieden
„Mich hat die Kunst gerettet“
Teil 1: Interview – Der Direktor des Kölner Museum Ludwig über die gesellschaftliche Rolle von Museen
„Ich glaube schon, dass laut zu werden Sinn macht“
Teil 2: Interview – Freie Szene: Die Geschäftsführerin des NRW Landesbüros für Freie Darstellende Künste über Förderkürzungen


