
„Wo Regelmäßigkeit anfängt, sollte Nachbarschaftshilfe aufhören“
Teil 2: Interview – Architektin Ulrike Scherzer über Wohnen im Alter
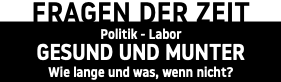
choices: Frau Scherzer, wollen Menschen sich eher zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen pflegen lassen?
Ulrike Scherzer: Zu Hause … Das ist, seit es diese Frage gibt, eigentlich immer dieselbe Antwort. Man zögert es bis zur allerletzten Minute hinaus, möglicherweise noch in ein Heim umziehen zu müssen. Die allermeisten Leute wollen in ihrem vertrauten Umfeld bleiben, in dem sie schon immer gewohnt haben. Natürlich ist es manchmal so, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht, weil einfach die Ressourcen drumherum nicht ausreichen, um das zu gewährleisten.
„Männer haben immer noch den Vorteil: Sie leben kürzer“
Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, zu Hause bleiben zu wollen oder nicht?
Ich vermute, das ist gleich. Die Männer haben immer noch den Vorteil: Sie leben kürzer beziehungsweise sind die Älteren, wenn sie heiraten. D.h., durch diese Kombination haben sie häufig automatisch ihre Gattin an der Seite für die letzten Meter. Das ist tatsächlich deutlich häufiger als umgekehrt. Bei Menschen, die alleine leben, vermute ich nicht, dass es da wirklich Unterschiede gibt.
Warum kann es manchmal schwierig sein, zu Hause zu bleiben?
Je pflegebedürftiger man wird, desto häufiger muss z.B. täglich ein Pflegedienst kommen. Ein großes Problem ist auch die Überforderung von Familienangehörigen, demente Personen zu Hause zu versorgen. Oftmals verstehen sie einfach nicht mehr, was mit ihnen passieren soll, machen möglicherweise die Nacht zum Tag und bringen damit alle an den Rand der nervlichen Belastung.
„Die Überforderung einer Familie wird häufig viel zu spät signalisiert“
Wo eventuell auch elektronische Geräte angestellt werden …
Das sind so die harmloseren Varianten. Es ist eine hochgradig belastende Situation, wenn man mit einem dementen Menschen in einem Haushalt wohnt, keinen Schritt mehr vor die Tür machen kann, ohne dass derjenige betreut sein muss, damit er sich nicht selbst Schaden zufügt, elektrische Geräte bedient oder wegläuft. Irgendwann ist auch der Moment gekommen, wo man sagt „Jetzt geht es zu Hause nicht mehr“. Bei Menschen, die überwiegend körperliche Probleme haben, kann das dann irgendwann auch nicht mehr von Familie und ambulanter Versorgung geleistet werden. Das ist auch je nach Region sehr unterschiedlich, wie gut eine ambulante Versorgung dort ist. Beispielsweise wird es auf dem Land immer schwieriger, da sich Pflegedienste zum Teil gar nicht mehr hinbewegen wollen, weil ihre Fahrzeiten nicht bezahlt werden. Die Überforderung einer Familie wird häufig auch viel zu spät signalisiert. Sie pfeifen schon komplett aus dem letzten Loch oder Pflegende sterben tatsächlich zuerst, während der Pflegebedürftige frisch geföhnt im Bett sitzt – platt formuliert. Diese Schwelle, sich einzugestehen, dass man es nicht mehr schafft, wird häufig viel zu spät erst gesehen.
Dazu kommt, dass die Familienpflege – im Moment in unserer Republik mengenmäßig noch die größte – ziemlich suboptimal läuft. Vieles passiert unter dem Radar von Ärzten. Es gibt keine Kontrolle darüber. Wenn z.B. ein alter, pflegebedürftiger Mensch von seiner Familie nicht gut versorgt wird oder sogar auch aggressiv behandelt, gibt es kein Amt, das dafür zuständig ist. Da wäre ein Regulativ nötig.
„Nie eine Dauerlösung, sondern nur eine Übergangsphase“
Für viele ist es nicht so einfach, vom Job in die Pflege der Eltern zu wechseln. Wie gehen Kinder diesen Schritt zusammen mit ihren Eltern an?
Ja, das ist ein super schwieriges Thema. Ich kenne jetzt auch nur ein paar Fälle persönlich. Also der Klassiker: Jemand war noch ganz gut zu Gange, plötzlich kommt ein Schlaganfall. Dann ist auf einmal Holland in Not und man hat so schnell keinen Pflegeplatz, muss erst einmal mit dem Arbeitgeber verhandeln. Um die Eltern überhaupt versorgen zu können, geht es meist dafür auch in eine andere Stadt. Ich habe das bei Leuten erlebt, die quasi online ihren Beruf noch für 20 Prozent weiter haben laufen lassen und im Grunde aber so lange gewartet haben, bis der Pflegeheimplatz da war. Das war nie eine Dauerlösung, sondern nur eine Übergangsphase, weil es in dem Moment keine andere Lösung gab.
Sonst wird es zur Doppelbelastung …
Ja, das kann man nicht dauerhaft tun. Es gibt natürlich Leute, die das wie eine Art Job machen. Aber das ist auch weiter auf dem Rückzug. Eine ganz große Zeit lang gab es auch dieses Selbstverständlichkeitsgefühl davon‚ „die Tochter oder die Schwiegertochter, die versorgt mich schon“. Und die Familien haben das auch irgendwie klaglos getan. Aber ich glaube, diese Zeiten sind schon jetzt ein bisschen vorbei.
Sie meinen die Erwartung, sich in diese Rolle zu begeben, die man vielleicht gar nicht ausfüllen möchte?
Ja.
„Ganz wenige sind wirklich vorausschauend unterwegs“
Wie gut bereiten sich denn ältere Menschen auf diesen Lebensabschnitt vor?
Gar nicht gut. 95 Prozent derer in dieser Altersgruppe, mit denen ich in meinem bisherigen Berufsleben zu tun hatte, verdrängen das erfolgreich und warten, bis es knallt. Und dann fangen sie an, mehr oder weniger hektisch nach Lösungen zu suchen. Ganz wenige sind wirklich vorausschauend unterwegs. Häufig sind es die, die schon immer alleinstehend waren. Sie müssen sowieso mehr darüber nachdenken, wie sie sich organisieren, wenn sie Hilfe brauchen. Diejenigen, die mit Kindern und größeren Familien zusammenhängen, lassen es meist einfach auf sich zukommen.
„Es wird erst in Notsituationen thematisiert“
Wie wichtig ist die Barrierefreiheit zuhause?
Ja, das ist genauso wie darüber nachzudenken, wie es mal wird, wenn man richtig alt ist: Das ist den Leuten meist komplett egal. Oder es wird erst dann thematisiert, wenn die erste Knie-OP ansteht oder irgendwelche Einschränkungen mobilitätstechnischer Art zunehmen – also anlassbezogen oder manchmal auch in Notsituationen. Es gibt tatsächlich aber auch welche, die, wenn eh irgendwas renoviert werden muss, z.B. ein Bad aus den 60er, 70er Jahren, dann auch darüber nachdenken, gleich eine bodengleiche Dusche einzubauen. Manche sind dann dafür offen. Es ist inzwischen auch eine Art Standard für jegliche Badausstattung geworden. Aber, dass man richtig gezielt darüber nachdenkt, wie man in einem Haus, in einer Wohnung auch in hohen Alter noch klarkommt, ist leider noch die Ausnahme. Es gibt sehr gute Wohnberatungsstellen, in denen man darüber eine ganze Menge erfahren kann, auch über Finanzierungshilfen usw. In NRW ist das schon immer ziemlich super. Da ist die Quote derer besser, die sich ein bisschen frühzeitiger darüber Gedanken machen, weil man einfach mehr mitbekommt, was andere Leute machen oder diese Beratungsstellen anbieten. Sie haben oft Musterwohnungen, in denen man sich Dinge angucken kann, wie sie idealerweise aussehen und realisiert werden können. Da kann man sich ein Bild machen, wie es z.B. aussieht, wenn ich den Maximalstandard für eine Rollstuhlnutzung einrichte oder was mit den begrenzten Flächen funktioniert, die ich bei mir vor Ort habe. Das ist total hilfreich und hat sich auch ziemlich etabliert.
Werden manchmal auch Bereiche eines Hauses stillgelegt?
Ja, gerade bei größeren Einfamilienhäusern habe ich das schon erlebt. Dass man da, wo es möglich ist, nur noch im Erd- und im Obergeschoss wohnt und das Dachgeschoss dann mehr oder weniger leer bleibt.
„Es geht bei der Miete nicht um Gewinn, sondern um eine Kostendeckung“
Wohnen wird mehr und mehr zur Generationenfrage: Die Älteren wohnen in zu großen Häusern, die Jüngeren müssen in kleinen Wohnungen ausharren. Wie kann man das cleverer denken?
Da gibt es schon eine ganze Weile ganz gute Ideen. Was immer schwierig ist, ist die große Menge der Häuslebesitzer, da man sie nicht wirklich gut erreicht. Was viel besser funktioniert, sind Wohngenossenschaften. Das sind Wohnungsunternehmen, die quasi ein Dach über diesem Wohnungsbestand bilden. Und es gibt Unternehmen, die ein ganz aktives und sozial begleitetes Umzugsmanagement machen. Dazu gehört auch, dass Wohnungen angeboten werden, die kleiner sind, aber nicht unbedingt teurer. Der Preis ist häufig der Grund, dass ältere Leute nicht in eine kleinere Wohnung umziehen, weil die große Wohnung, die sie seit 40 Jahren haben, relativ günstig ist. Wenn sie in eine kleinere umziehen müssten, wäre die dann teurer und deswegen machen sie es nicht. Und diese finanzielle Schleife funktioniert bei den Genossenschaften ziemlich gut, da sie eben keine Rendite mit ihren Wohnungen erwirtschaften müssen, sondern der genossenschaftliche Ansatz ist: Das gehört allen zusammen. Man hat ein lebenslanges Wohnrecht. Es geht bei der Miete nicht um Gewinn, sondern um eine Kostendeckung.
„Sie waren komplett damit überfordert“
Haben Sie ein Beispiel für ein Wohnprojekt, das jemand sich schon frühzeitig überlegt hat?
Ja, ich hatte mal in einem Interview eine Dame, die zuvor selbst Leiterin eines Altenheims gewesen ist. Als sie in den Ruhestand gegangen ist, hat sie gesagt, „ich möchte dieses ganze Theater mal nicht erleben, das ich zum Teil mit Familien erlebt habe. Ich organisiere mir ein gemeinschaftsorientiertes Wohnprojekt“. Das zu planen hat auch eine ganze Weile gedauert. Mit noch nicht ganz 70 Jahren ist sie mit mehreren ähnlich alten Menschen da eingezogen. Es waren insgesamt 15 Wohnungen. Ich habe sie dort interviewt. Da war sie schon so gut über 80 und die anderen auch. Dann passierte das, was in der Phase des rüstigen Rentner-Daseins problematisch wird: Je hilfsbedürftiger jeder wurde, desto schwieriger wurde es und desto mehr Probleme hatten sie damit, auch, ihre eigenen Grenzen zu setzen. Das Versprechen, dass sie sich alle gegenseitig gegeben hatten – dafür zu sorgen, dass keiner von ihnen ins Heim muss – war irgendwann nicht mehr zu halten, sie waren komplett damit überfordert. Deswegen plädiere ich immer dafür, dass man eine gewisse Altersmischung anstrebt, wenn man sich in so ein gemeinschaftsorientiertes Wohnen begibt. Damit nicht nur Menschen miteinander wohnen, die dann gemeinsam hochaltrig werden, sondern, dass Möglichkeiten der Hilfeleistungen untereinander existieren, durch eine gute Altersmischung.
„Es ist völlig normal, dass man in derselben Lebensphase mehr miteinander macht“
Gibt es Konzepte, in denen junge Familien den älteren helfen? Wer tut sich da zusammen?
Ja, ich hatte mal eine Studie gemacht, um genau das herauszufinden. Wir konnten feststellen, dass sich Altersgruppen untereinander die meiste Unterstützung bieten. Eigentlich ist es völlig normal, dass man in derselben Lebensphase mehr miteinander macht und sich unterstützt. Trotzdem ist es ganz hilfreich, wenn die Rentnergruppe breiter gefächert ist und darin Leute nicht nur um die 60, sondern zwischen 60 und 90 leben. Dann können sie sich untereinander besser unterstützen. Es kommt auch darauf an, dass diese Projekte groß genug sind. Wenn sie nur aus sieben Haushalten bestehen, ist das Unterstützungspotenzial schnell erschöpft. Wenn es aber 30 in einer guten Altersmischung sind, dann ist einfach mehr untereinander möglich. Projekte, in denen klar ist: Wenn regelmäßige Unterstützung nötig wird, wird auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen, laufen gut. Dass dabei nicht die Erwartungshaltung entsteht „ich wohne in einem Gemeinschaftswohnprojekt und die Anderen helfen mir mit jeglichen Anforderungen, die ich an sie habe“. Denn wo Regelmäßigkeit anfängt, sollte Nachbarschaftshilfe aufhören.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 Hört das Signal
Hört das Signal
Intro – Gesund und munter
 von ch-thema-s1-online-678.jpg) So ein Pech
So ein Pech
Teil 1: Leitartikel – Opfer von Behandlungsfehlern werden alleine gelassen
 von ch-thema-s2-678.jpg) „Der Arzt muss dieses Vertrauen würdigen“
„Der Arzt muss dieses Vertrauen würdigen“
Teil 1: Interview – Kommunikationswissenschaftlerin Annegret Hannawa über die Beziehung zwischen Arzt und Patient
 von ch-thema-s3-678.jpg) Gesundheit ist Patientensache
Gesundheit ist Patientensache
Teil 1: Lokale Initiativen – Die Patientenbeteiligung NRW in Köln
 von tr-thema-s1-online-678.jpg) Heimat statt Pflegeheim
Heimat statt Pflegeheim
Teil 2: Leitartikel – Seniorengerechtes Bauen und Wohnen bleibt ein Problem
 von tr-thema-s3-678.jpg) Gemeinsam statt einsam
Gemeinsam statt einsam
Teil 2: Lokale Initiativen – Wohnen für Senior:innen bei der Baugenossenschaft Bochum
 von en-thema-s1-online-678.jpg) Privatvergnügen
Privatvergnügen
Teil 3: Leitartikel – Die Zweiklassenmedizin diskriminiert die Mehrheit der Gesellschaft
 von en-thema-s2-678.jpg) „Das Gesundheitssystem wird unter Druck geraten“
„Das Gesundheitssystem wird unter Druck geraten“
Teil 3: Interview – Arzt Bernhard Winter über den Vorwurf einer Zweiklassenmedizin
 von en-thema-s3-678.jpg) Verbunden für die Gesundheit
Verbunden für die Gesundheit
Teil 3: Lokale Initiativen – Wuppertals Selbsthilfe-Kontaktstelle unterstützt Bürgerengagement
 von chtren-thema-europa-678.jpg) Senioren und Studenten müssen warten
Senioren und Studenten müssen warten
Das Wohnprojekt Humanitas Deventer verbindet Generationen – Europa-Vorbild: Niederlande
 von chtren-thema-glosse-678.jpg) Wenn der Shareholder das Skalpell schwingt
Wenn der Shareholder das Skalpell schwingt
… und der Patient zur Cashcow wird – Glosse
„Man darf auswählen, wem man sich unterwerfen will“
Teil 1: Interview – Religionssoziologe Gert Pickel über christliche Influencer
„Es wird versucht, das Strafrecht als politisches Mittel zu nutzen“
Teil 2: Interview – Juristin Susanne Beck über Gewalt gegen Frauen
„Es geht um Kontrolle über Menschen, die schwanger werden können“
Teil 3: Interview – Medizinerin Alicia Baier zum Streit über Schwangerschaftsabbrüche
„Die Wut unserer Generation ist keine Laune!“
Menschenrechts-Aktivistin Jennifer Follmann über den Frauenstreik zum 9. März
„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“
Teil 1: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung
„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“
Teil 2: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen
„Weit von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit entfernt“
Teil 3: Interview – Die Rechtswissenschaftlerin Lisa Kadel über die Kriminalisierung von Klimaaktivist:innen
„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“
Teil 1: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns
„Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor“
Teil 2: Interview – Sprachwissenschaftler Thomas Niehr über Sprache in Politik und Populismus
„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“
Teil 3: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen
„Je größer das Vermögen, desto geringer der Steuersatz“
Teil 1: Interview – Finanzwende-Referent Lukas Ott über Erbschaftssteuer und Vermögensungleichheit
„Eine neue Ungleichheitsachse“
Teil 2: Interview – Soziologe Martin Heidenreich über Ungleichheit in Deutschland
„Die gesetzliche Rente wird von interessierter Seite schlechtgeredet“
Teil 3: Interview – VdK-Präsidentin Verena Bentele über eine Stärkung des Rentensystems
„Besser fragen: Welche Defensivwaffen brauchen wir?“
Teil 1: Interview – Philosoph Olaf L. Müller über defensive Aufrüstung und gewaltfreien Widerstand


