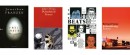Literatur.
Kompakte Kost gegen Pixelströme
Die Zeitungen sind morgen vielleicht schon verschwunden Textwelten 01/11
Heute lesen wir sie noch, aber morgen können sie schon verschwunden sein. Nur noch sieben Jahre wird es in den USA gedruckte Zeitungen geben. So jedenfalls sieht es der australische Zukunftsforscher Ross Dawson, wie die Akademie Berufliche Bildung der Zeitungsverleger in ihrem Newsletter berichtet. Dawson, der zu den umworbensten Beratern unserer Tage gehört, rechnet weiter: In neun Jahren hat das letzte Stündlein der Zeitungen in England geschlagen, in Deutschland wird es noch bis 2031 gedruckte Zeitungen geben – wobei man sich fragen darf, wie die dann wohl aussehen mögen –, und als letzte dürfen die Menschen in den heutigen Entwicklungsländern so um das Jahr 2050 noch ein Stück Zeitungspapier in Händen halten.
Aufgegeben
Bibliotheken zugrunde gespart - Textwelten 12/10
Sparschweine sind dazu da, dass man sie mit Geld mästet. Es gibt aber auch Sparschweine, denen man nichts zu futtern lässt, sondern an deren Unterhalt man noch spart. Das sind sogenannte arme Schweine. Die muss Monika Ziller, Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbands, gemeint haben, als sie jetzt von den Bibliotheken als den „Sparschweinen der kommunalen Haushalte“ sprach. Seit den Neunziger Jahren wurde das Netz der öffentlichen Bibliotheken ausgedünnt, und dennoch ist ihre Nutzung seit der Jahrtausendwende um 22 Prozent gestiegen. Der soeben erschienene „Bericht zur Lage der Bibliotheken in Deutschland“ belegt, dass die rund 11.000 Bibliotheken über 200 Millionen Besucher und 466 Millionen Ausleihen im letzten Jahr vorzuweisen haben.
Tanklust unterm Tannenbaum
Sebastian23 zählt an: Drei - die Video-Kolumne - Poetry 12/10
Der Dezember ist für mich eine angeschneite Mischung aus Mutter Theresa und Paris Hilton. Er ist Theresa Hilton, die monatgewordene Manifestation von schrillem Schein und wahrer Wohltat. Er ist ein einziges Fest und ein eisiger Frost; mehr noch, der Dezember ist Zuckerwatte und Zahnarzt in einem.
Draußen wird es kälter, was sich positiv auf meine Formulierfreude auswirkt, da ich mehr Zeit damit verbringe, kunstvoll Prädikat an Nomen zu löten. Ich war nicht mehr draußen, seit der Pool im Garten meines Herrenhauses mit einer puckdicken Eisschicht überzogen ist. Das sind 2,54 Zentimeter, habe ich gerade im Regelbuch des deutschen Eishockeyverbandes nachgeschlagen. Ansonsten besitze ich übrigens keine Bücher, sondern nur Heftchen.
In Heftchen stehen nämlich gloriosere Sätze. Nehmen wir das Monatsmagazin der Deutschen Bahn, das „mobil“. Da las ich vor kurzem in einem Artikel über Uhrmacher folgende Passage: „Die Dings und Dongs sind eine Freude für den Benutzer, aber eine Qual für jeden Uhrmacher. Die Repetition ist für ihn das, was der Mount Everest für einen Bergsteiger bedeutet: der schmerzhafte Gipfel der Gefühle.“
Herz und Hirn
Lesen ist mehr als das Entziffern von Buchstaben und Icons - Textwelten 11/10
Textwelten entstehen im Kopf. Zeichen für Zeichen, Buchstabe für Buchstabe setzen wir aneinander. Jeder einzelne Buchstabe wird mit der Geschwindigkeit von 50 Millisekunden in unserem Gehirn identifiziert und in Kombination mit dem nächsten gesetzt. Der Franzose Stanislas Dehaene, Professor am Collège de France für Experimentelle Wahrnehmungspsychologie, entschlüsselte jetzt einige der wichtigsten Geheimnisse des Lesephänomens. Interessant gerade für deutsche Leser, weil ihnen die Rechnung für jahrzehntelange Lehrmethoden präsentiert wird.
Historische Geschichten
ComicKultur 11/10
Reinhard Kleist brachte von einer Kuba-Reise das atmosphärische Skizzenbuch „Havanna“ mit. Seine Beschäftigung mit Kuba führte außerdem zu einer „Castro“-Biografie. Kleist spielt aber glücklicherweise nicht den zeichnenden Historiker. Er erdichtet den deutschen Journalisten Karl Mertens, durch dessen schwärmerischen Blick wir auf die Revolution in Kuba und die kommenden Ereignisse blicken.
Der Präsident und Coco
Sebastian23 zählt an: Zwei - die Video-Kolumne - Poetry 11/10
Es war in den frühen 90er Jahren, in der kurzen Zeitspanne zwischen den neonbunten Jogginganzügen des Pop und den Holzfäller-Hemden des Grunge. Es war, bevor House Tekkno hieß – es war sogar, bevor Tekkno Techno hieß.
Wenn Teenager Fragen stellen
Dänischer Roman entwickelt sich zum Skandalbuch - Textwelten 10/10
Es ist ein Jugendbuch, und die Teenager sollen es lesen. Aber dass Janne Tellers Roman „Nichts – was im Leben wichtig ist“ an Dänemarks Schulen verboten wurde, kann man leicht nachvollziehen. Inzwischen entwickelte sich das nun im Carl Hanser Verlag erschienene Skandalbuch zum internationalen Bestseller, der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde.
Ways of Life
Wortwahl 10/10
Er ist natürlich das Ereignis auf der Frankfurter Buchmesse (6.-10.10.). Er war es auch, als er nur einen mehr oder minder schwachen Abglanz seiner „Korrekturen“ produzierte, die ihn 2001 jäh in den Literatur-Olymp katapultierten. Doch jetzt meldet sich Jonathan Franzen tatsächlich zurück; mit kaum mehr für möglich gehaltener Fulminanz. Entgegen der Vielzahl belletristischer One-Hit-Wonder hat sich der Amerikaner wieder seiner Stärken besonnen respektive diese sogar verfeinert.
Heidenspaß
ComicKultur 10/10
Literaturadaptionen im Comicbereich gibt es in diesem Monat gleich zwei: Corbeyan und Horne haben sich Franz Kafkas Novelle „Die Verwandlung“ vorgenommen. Eigentlich eine Geschichte, die man gar nicht so grafisch vor Augen haben möchte. Und so ist latenter Ekel vorprogrammiert, wenn man die zugegebenermaßen gelungene Umsetzung in düsteren Zeichnungen von Horne goutiert (Knesebeck). Mit Marcel Prousts „Die Suche nach der verlorenen Zeit“ hat sich Stéphane Heuet ein etwas umfangreicheres Werk ausgesucht. In fünf Bänden visualisiert er Prousts subjektivistische Erinnerungsreise in wundervollen Ligne Claire-Bildern mit Jugendstil-Flair. Gleich im ersten Band „Combray“ findet er eine treffende Umsetzung für die berühmte, Kindheitserinnerungen auslösende Madeleine im Tee (Knesebeck).
Galanter Grusel
Im Portrait: Der Wuppertaler-Krimiautor Stefan Melneczuk - Portrait 09/10
In Stefan Melneczuks Werken fegt ein kalter Schauer über das Papier. Der Mystery-Thriller „Marterpfahl“ gibt Lesern die Chance, noch mehr über die verschiedenen Facetten von Gänsehauteffekten zu erleben. Stefan Melneczuk ist einer von diesen charmanten Männern, die mehr zuhören als selbst zu erzählen, unaufdringlich zuvorkommend sind, einen guten Humor haben, aber fast ein bisschen schüchtern wirken.

Die Liebe und ihre Widersprüche
„Tagebuch einer Trennung“ von Lina Scheynius – Textwelten 11/25
Inmitten des Schweigens
„Aga“ von Agnieszka Lessmann – Literatur 11/25
Mut zum Nein
„Nein ist ein wichtiges Wort“ von Bharti Singh – Vorlesung 10/25
Kindheitserinnerungen
„Geheimnis“ von Monika Helfer und Linus Baumschlager – Vorlesung 10/25
Appell an die Menschlichkeit
Navid Kermanis Lesung im MAKK – Lesung 10/25
Im Spiegel des Anderen
„Der Junge im Taxi“ von Sylvain Prudhomme – Textwelten 10/25
Die Front zwischen Frauenschenkeln
„Der Sohn und das Schneeflöckchen“ von Vernesa Berbo – Literatur 10/25
Alpinismus im Bilderbuch
„Auf in die Berge!“ von Katja Seifert – Vorlesung 09/25
Keine Angst vor Gewittern
„Donnerfee und Blitzfee“ von Han Kang – Vorlesung 09/25
Roman eines Nachgeborenen
„Buch der Gesichter“ von Marko Dinić – Literatur 09/25
Süß und bitter ist das Erwachsenwerden
„Fliegender Wechsel“ von Barbara Trapido – Textwelten 09/25
Geteilte Sorgen
„Lupo, was bedrückt dich?“ von Catherine Rayner – Vorlesung 08/25
Augen auf Entdeckungsreise
„Jetzt geht’s los!“ von Philip Waechter – Vorlesung 08/25
Erste Male zwischen den Welten
„Amphibium“ von Tyler Wetherall – Literatur 08/25
Düster und sinnlich
„Das hier ist nicht Miami“ von Fernanda Melchor – Textwelten 08/25
Die Kraft der Erinnerung
„Das Geschenk des Elefanten“ von Tanja Wenz – Vorlesung 07/25
Eine wahre Fluchtgeschichte
„Wie ein Foto unser Leben rettete“ von Maya C. Klinger & Isabel Kreitz – Vorlesung 07/25
Zart und kraftvoll zugleich
„Perlen“ von Siân Hughes – Textwelten 07/25
Alternative Realität in Tokyo
„Tokyo Sympathy Tower“ von Rie Qudan – Literatur 07/25
Bis zur Neige
„Der Durst“ von Thomas Dahl – Literatur 06/25
Im Reich der unsichtbaren Freunde
„Solche Freunde“ von Dieter Böge – Vorlesung 06/25
Ein Hund als Erzähler
„Zorro – Anas allerbester Freund“ von Els Pelgrom und Sanne te Loo – Vorlesung 06/25
Flucht ins Metaverse
„Glühfarbe“ von Thea Mantwill – Literatur 06/25
Ein Leben, das um Bücher kreist
„Roberto und Ich“ von Anna Katharina Fröhlich – Textwelten 06/25
Die Spielarten der Lüge
„Die ganze Wahrheit über das Lügen“ von Johannes Vogt & Felicitas Horstschäfer – Vorlesung 05/25






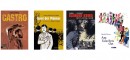

.JPG)