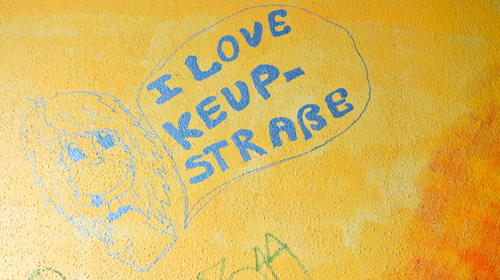
„Ich glaube, dass der Rechtsradikalismus phänomenal unterschätzt wird“
Kutlu Yurtseven über den Anschlag auf der Keupstraße und Rassismus aus der Mitte – Thema 06/14 Rechtsdrehung
choices: Herr Yurtseven, wie haben Sie den Anschlag vor zehn Jahren erlebt?
Kutlu Yurtseven: Also für mich war das eher ein mediales Erleben. Ich war auf der Arbeit und dann haben Freunde angerufen und gesagt: „Kutlu, da ist ne Bombe hochgegangen in der Keupstraße.“ Den Rest habe ich im Internet erfahren. Darum war die Situation für mich zuerst nicht real. Erst als ich am Abend zur Keupstraße bin, wurde der Anschlag für mich wirklich. Die Nägel habe ich aber nicht mehr gesehen.
Was hat der Anschlag für die Keupstraßen-Community bedeutet?

Da war eine große Verzweiflung bei den Bewohnern der Keupstraße – aber auch bei vielen Kölnern. Doch als Innenminister Schily dann zwei oder drei Tage später einen rechtsterroristischen Akt ausschloss, war das wie ein Schlag ins Gesicht. Und so hat die Bombe mithilfe des Staates und seiner Behörden dann doch ihren Zweck erreicht: Angst zu verbreiten und Existenzen zu vernichten.
Wie kam Schily zu seiner Einschätzung?
Ich glaube, die Haltung dahinter war: Was nicht sein darf, das gibt es auch nicht. Viele sind durch die Vergangenheit sensibilisiert und das Schreckgespenst einer Nazi-Szene die Gewalt ausübt und mordet, wollte man nicht wahr haben. Und ich glaube auch, dass der Rechtsradikalismus phänomenal unterschätzt wird.
Unterschätzt?
Das Problem ist, dass jedes Land, das ich kenne, einen konservativen Grundkonsens hat. Es können linke Parteien regieren, der Grundkonsens ist und bleibt konservativ. Die breite Masse ist konservativ, darum ist Rassismus auch ein Problem der Mitte der Gesellschaft.
Rassismus aus der Mitte. Wie stellt der sich dar?
Ich will gar nicht von denen reden, die einem an der Kasse das Geld nicht in die Hand geben. Oft sind es die, die mit dir leben, sich mit dir unterhalten. Du hältst sie für reflektiert und offen und dann kommt zum Beispiel eine Lehrerin und sagt: Warum macht ihr Abitur, ihr heiratet doch eh in zwei drei Jahren. Oder ich wurde mal gefragt, ob mein Vater meine Mutter auch schlage. Warum fragt der mich das? Rassismus und Intoleranz scheinen sehr tolerante Eigenschaften zu sein, weil sie jeden befallen können, unabhängig von Nationalität, Religion oder Bildungsstand.
Welche Rolle spielten diese Motive in der Medienberichterstattung?
Da gibt es zwei Dinge: Erstens muss die Zeitung verkauft werden und darum werden die niederen Instinkte der Leser bedient, weil sich das gut verkauft. Und zweitens macht Rassismus vor Intellektuellen oder Journalisten nicht halt. Und das Bedienen niederer Instinkte, das fängt doch bei diesen ganzen komischen Vor- und Nachmittagssendungen im Privatfernsehen an. Da werden auch nur niedere Instinkte bedient und die bereiten den Boden für diesen Dreck.
Wie sehen Sie die Kampagne: „Wer betrügt der fliegt“ von der CSU Anfang des Jahres?
Das passt voll rein in das Schema Rassismus aus der Mitte. Als in Mölln oder Solingen Familien verbrannt wurden, das war zu Zeiten von Slogans wie „Das Boot ist voll“. Politik ist mit den Stimmungen, die sie erzeugt, oft der Wegbereiter. Auch die Keupstraße wurde oft schlecht gemacht. Und das ist ein ganz gefährliches Spiel. Rechtsextreme denken dann oft: Die Politiker wollen gerne, können aber nicht, also springen wir in die Bresche und vollstrecken den Willen der schweigenden Mehrheit. Die Unterschriftenkampagne der CDU gegen die doppelte Staatsbürgerschaft war auch so eine Aktion.Was mich aber interessiert ist, was mit Uckermann von Pro-Köln passiert?
Sie meinen Jörg Uckermann, den Kölner Ratsherr von Pro-Köln, der derzeit mit weiteren Fraktionskollegen wegen Betrugs vor Gericht steht?
Den meine ich. Wo fliegt der denn jetzt hin? Kann mir das mal einer sagen? Der ist nicht nur gierig, der ist auch noch ein Vollidiot.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 von nrw-theater999.jpg) And the winner is …
And the winner is …
Auswahl der Mülheimer Theatertage – Theater in NRW 04/23
 Welche Zukunft wollen wir?
Welche Zukunft wollen wir?
raum13 droht das Aus im Otto-und-Langen-Quartier – Spezial 11/20
 Neue Perspektiven in Mülheim
Neue Perspektiven in Mülheim
Goethes „Hermann und Dorothea“ im Stadtraum – Bühne 09/20
 Modellprojekt für kreative Urbanität
Modellprojekt für kreative Urbanität
Mülheimer „Zukunfts Werk Stadt“ zu Gast im hdak-Kubus – Spezial 11/19
 Rechts stummschalten
Rechts stummschalten
Christian Fuchs diskutiert im NS-Dok über die Neue Rechte – Spezial 10/19
 Wandel mitgestalten
Wandel mitgestalten
Das Zeitspiralfedern-Festival von raum13 – Bühne 10/18
 Sieben Jahre Stigmatisierung
Sieben Jahre Stigmatisierung
Mahnmal-Diskussion in der Keupstraße – Spezial 06/18
 Mülheim am Scheideweg (2)
Mülheim am Scheideweg (2)
Veedel zwischen Aufbruch und Gentrifizierung – Spezial 05/18
 Mülheim am Scheideweg (1)
Mülheim am Scheideweg (1)
Veedel zwischen Aufbruch und Gentrifizierung – Spezial 05/18
 Mahnmal der Schande
Mahnmal der Schande
Verpfuschtes Gedenken an NSU-Opfer – Theaterleben 04/18
 Nüchterne Eier
Nüchterne Eier
Marie Rotkopf mit „Antiromantisches Manifest“ im King Georg – Literatur 03/18
 Tradition und Handel
Tradition und Handel
Comicmesse Köln in der Mülheimer Stadthalle – Literatur 11/17
„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“
Teil 1: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung
„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“
Teil 2: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen
„Weit von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit entfernt“
Teil 3: Interview – Die Rechtswissenschaftlerin Lisa Kadel über die Kriminalisierung von Klimaaktivist:innen
„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“
Teil 1: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns
„Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor“
Teil 2: Interview – Sprachwissenschaftler Thomas Niehr über Sprache in Politik und Populismus
„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“
Teil 3: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen
„Je größer das Vermögen, desto geringer der Steuersatz“
Teil 1: Interview – Finanzwende-Referent Lukas Ott über Erbschaftssteuer und Vermögensungleichheit
„Eine neue Ungleichheitsachse“
Teil 2: Interview – Soziologe Martin Heidenreich über Ungleichheit in Deutschland
„Die gesetzliche Rente wird von interessierter Seite schlechtgeredet“
Teil 3: Interview – VdK-Präsidentin Verena Bentele über eine Stärkung des Rentensystems
„Besser fragen: Welche Defensivwaffen brauchen wir?“
Teil 1: Interview – Philosoph Olaf L. Müller über defensive Aufrüstung und gewaltfreien Widerstand
„Als könne man sich nur mit Waffen erfolgreich verteidigen“
Teil 2: Interview – Der Ko-Vorsitzende des Bundes für Soziale Verteidigung über waffenlosen Widerstand
„Das ist viel kollektives Erbe, das unfriedlich ist“
Teil 3: Interview – Johanniter-Integrationsberaterin Jana Goldberg über Erziehung zum Frieden
„Mich hat die Kunst gerettet“
Teil 1: Interview – Der Direktor des Kölner Museum Ludwig über die gesellschaftliche Rolle von Museen


